Die erste Weltumsegelung (1519 – 1522)
- von Werner Altmann
- •
- 13 Aug., 2019
- •
von Fernando de Magallanes und Juan Sebastián Elcano

Am 10. August 1519 verließen fünf Schiffe Sevilla und es begann eine der längsten und gefährlichsten Expeditionen, die die Welt bis dahin gesehen hat. Den Auftrag dazu hatte der noch junge spanische König Karl I. erteilt. Das Unternehmen war sorgfältig vorbereitet, die Finanzierung gesichert (75 % übernahm die kastilische Krone, 25 % private Geldgeber) und ein Vertrag, die so genannten capitulaciones de Valladolid, zwischen dem König und Fernando de Magallanes, einem gebürtigen Portugiesen, abgeschlossen. Die kleine Flotte segelte zuerst die westafrikanische Küste entlang, überquerte dann in südwestlicher Richtung den Atlantischen Ozean, bis sie nach viermonatiger Fahrt die brasilianische Ostküste erreichte. Entlang der südamerikanischen Küste erreichten sie den Rio de la Plata, der kurz zuvor von Juan Díaz de Solís entdeckt worden war, und landeten schließlich in der Bucht von San Julián im Süden Patagoniens.
Das Ziel der Reise war nicht eine geplante Weltumseglung zum Ruhme der spanischen Monarchie, auch keine geographische wissenschaftliche Expedition zur Erforschung des noch fast unbekannten amerikanischen Kontinents. Der königliche Auftrag verfolgte ausschließlich wirtschaftliche Interessen. Ein schnellerer Seeweg zur Inselgruppe der Molukken, den so genannten „Gewürzinseln“, im Indischen Ozean sollte gefunden werden, um so begehrte Produkte wie Pfeffer, Muskat oder Zimt billiger nach Europa bringen zu können.
Nachdem eine Meuterei der Mannschaften und Kapitäne der anderen vier Schiffe, die schnellstmöglich nach Europa zurückkehren wollten, von Magallanes erfolgreich vereitelt wurde, begann die Suche nach einer Passage, um vom Atlantik in das „Meer des Südens“, den Pazifischen Ozean, zu gelangen. Die gefährliche Durchfahrt (heute: „Magellanstraße“) durch völlig unbekanntes Terrain und bei extremen klimatischen Bedingungen führte zum Verlust eines Schiffes. Ein weiteres Schiff, die San Antonio, auf dem ausgerechnet die Lebensmittel für die ganze Schiffsbesatzung gelagert waren, machte sich Richtung Europa aus dem Staub. Die Folge war, dass viele Seemänner entweder in den unberechenbaren Fluten umkamen oder, da es zum Essen nur noch tote Ratten gab, schlichtweg verhungerten. Als nach geglückter Durchfahrt weit und breit kein Festland zu sehen war, sank die Stimmung an Bord auf ihren Tiefststand. Antonio Pigafetta, der als Chronist an dem Unternehmen teilnahm, hat uns darüber einen erschütternden Bericht hinterlassen.
Nur dem eisernen Willen und der unbeugsamen Durchsetzungskraft von Kapitän Magallanes war es zu verdanken, dass die drei noch verbliebenen Schiffe nach über eineinhalbjähriger Abwesenheit von Europa die später nach dem spanischen König Philipp II. benannten Philippinen erreichten. Auf der kleinen Insel Mactán kam es dann zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit der einheimischen Bevölkerung. Magallanes wurde von einem Giftpfeil getroffen und starb am 27. April 1521.
Die stark dezimierte Mannschaft verbrannte die Concepción und verteilte sich auf die beiden noch verbliebenen Schiffe, die Trinidad und die Victoria, wählte als Kapitän den Basken Juan Sebastián Elcano (zusammen mit Gonzalo Gómez de Espinoza), belud die Schiffe auf den Molukken mit den teuren Gewürzen und suchte so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Nachdem auch noch die Trinidad aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten zurückbleiben musste, wählte Elcano für den Rückweg den zwar bekannten Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung und entlang Westafrikas, riskierte aber, von den Portugiesen, deren „Hoheitsgebiet“ er durchfahren musste, aufgegriffen zu werden. Er hatte Glück und erreichte mit der Victoria am 6. September 1522 das spanische Festland. Die Trinidad, die nach erneuter Instandsetzung eine andere Fahrroute gewählt hat, kehrte, nachdem es von der portugiesischen Flotte attackiert wurde, erst 1525 nach Spanien zurück.
Die Bilanz sah nicht besonders gut aus: Von der ursprünglichen Besatzung, die zwischen 200 und 250 Männer zählte (die Zahlen variieren in den Berichten), kamen nur 18 auf der Victoria und 8 auf der Trinidad heil nach Hause. Drei Schiffe gingen zur Gänze verloren, die beiden anderen ziemlich angeschlagen. Die Victoria musste sogar von Sanlúcar de Barrameda den Guadalquivir flussaufwärts bis Sevilla abgeschleppt werden. Unter den Überlebenden befand sich auch ein Deutscher, Hans von Aachen, von dem wir so gut wie gar nichts wissen, Er muss auf jeden Fall ein mutiger Mann gewesen sein, machte er doch die Reise zu den Molukken ein zweites Mal und kehrte nach über 13 Jahren als einziger Überlebender – übrigens mit Hilfe der portugiesischen Flotte – nach Europa zurück.
Anlässlich der Feiern zum 500-jährigen Gedenkjahr entstand ein törichter Streit zwischen Spanien und Portugal. Im Januar 2017 hatte die portugiesische Regierung einen Antrag bei der UNESCO gestellt, die Weltumseglung auf die Liste des Weltkulturerbes zu setzten – ohne Spanien darüber zu informieren oder gar mit einzubeziehen. Im Gegenzug schuf die spanische Regierung im Juni desselben Jahres eine Kommission, die die über 100 geplanten Projekte finanziell fördern und organisatorisch betreuen sollte – natürlich wurden die Portugiesen daran nicht beteiligt. In den letzten Monaten verschärfte sich die gegenseitige Ausgrenzung, als sich die Historiker beider Seiten zu Wort meldeten. Am 1. März 2019 erließ die Real Academia de Historia auf Bitten des Chefredakteurs der konservativen Tageszeitung ABC eine offizielle Verlautbarung, die zu dem Schluss kam, die Schiffsexpedition sei „fraglos“ eine reine und ausschließliche Angelegenheit Spaniens gewesen. Historiker aus Portugal, die immer nur den „Portugiesen“ Fernão de Magalhães als Protagonisten des Unternehmens erwähnen und den Namen Elcanos meist unerwähnt lassen, konterten mit der These, bei der Weltumsegelung handle es sich um ein rein „zufälliges“ Ereignis , das so nicht beabsichtigt war. Schließlich kam es doch noch zu einer Einigung auf Ministerebene, die aber erst noch zeigen muss, ob und in welcher Weise die Projekte und Veranstaltungen der kommenden zwei Jahre gemeinsam durchgeführt werden.
Es handelt sich bei der maritimen Expedition tatsächlich eher um ein „europäisches“ Unternehmen. Magallanes ist mit seinem Projekt beim portugiesischen König Manuel I. dreimal gescheitert. Dann siedelte er nach Sevilla über, überzeugte Karl I. von seinem Vorhaben, der die Flotte finanziell auf die Beine stellte (wozu auch die Augsburger Kaufmannsfamilie der Fugger einen Anteil beisteuerte) und eine multinationale, aus mehreren europäischen Staaten stammende Besatzung auf den Weg schickte. Magallanes selbst hat mit seinem Geburtsland komplett gebrochen, hat sich als Vasall in den Dienst des kastilischen Königs gestellt und seinen ursprünglichen Namen „españolisiert“. Und schließlich hat ein baskischer Kapitän das auf halbem Weg vor dem Scheitern stehende Projekt erfolgreich zu Ende geführt. So sieht internationale Zusammenarbeit aus!
Es war heute ein ganz besonderer Tag für die Bewohner Madrids. Nachdem am 8. März der Rastro , der europaweit älteste Flohmarkt, wegen der Corona-Krise hatte schließen müssen, eröffnete er heute nach über acht Monaten wieder seine Läden und Stände, allerdings nur mit 50 Prozent seines normalen Umfangs und mit einer Reduzierung der Besucherzahl auf etwa die Hälfte, die vor der Pandemie gezählt wurde. Drohnen aus der Luft und Dutzende von Polizeifahrzeugen überwachten aus der Luft und an den Zufahrtsstraßen das Betreten des Areals.
Der Markt für Antiquitäten, Gemälde, aber auch für allerlei gebrauchte Gegenstände und billige Kleidung „aus zweiter Hand“ wurde 1740 offiziell gegründet und hat seitdem sein Gesicht mehrfach geändert. Ursprünglich standen hier Gebäude des alten Schlachthofes, am südlichen Rand des damaligen Stadtkerns. Das Gelände, das der Rastro heute bedeckt, beginnt oben an der Plaza de Cascorro (mit der Statue Eloy Gonzalos, der das 1896 belagerte Dorf Cascorro während des kubanischen Befreiungskampfes den Händen der Aufständischen entriss) und erstreckt sich abwärts über die Straßen Ribera de los Curtidores (benannt nach den Gerbern, die hier ihre Werkstätten hatten und das Blut der Schlachttiere den steilen Hang hinunter in den Río Manzanares entsorgten) und der Calle Carlos Arniches (im Jahre 1931 dem bekannten und beliebten Komödiendichter und Maler pittoresker Bilder des volkstümlichen Madrid gewidmet). Das westliche Ende bildet die Plaza del Campillo Nuevo Mundo an der Ronda de Toledo.
Seit einer Reihe von Jahren wurde der Rastro zu einem der beliebtesten Orte an Sonn- und Feiertagen zum Kaufen, Feilschen, Tauschen oder ganz einfach zum Bummeln, Schauen und ein Bad in der Menge genießen. Wer sich etwas auskennt, steuert gezielt bestimmte Plätze oder Straßen an, um die Objekte seiner Begierde zu finden.
In der Calle Fray Ceferino González hörte ich während meines ersten längeren Madrid-Aufenthaltes Mitte der 70er Jahre noch alle möglichen Arten von Vogelgezwitscher. Singvögel wurden neben anderen lebenden Tieren hier zum Verkauf angeboten. Obwohl ich eher auf der Suche nach alten Zeitschriften und gebrauchten Büchern aus der Franco-Zeit war, spazierte ich doch immer wieder durch diese Straße wegen ihres einzigartigen Flairs, das ich in Deutschland noch nie erlebt habe. Den Handel mit lebenden Tieren auf offener Straße verbot der Stadtrat wenige Jahre später. Heute beschränkt man sich auf allerlei notwendiges, aber auch höchst überflüssiges Accessoire für Hunde und Katzen oder originelle Vogelkäfige. In der Calle San Cayetano findet man eine reiche Auswahl von Gemälden und Bilderrahmen und auf der Plaza de Campillo del Nuevo Mundo treffen sich hauptsächlich Jugendliche, um Fußballbilder oder Comichefte zu tauschen.
Zwischen 14 und 15 Uhr leeren sich die Straßen des Rastro und füllen sich die zahlreichen Restaurants in der näheren Umgebung. Sowohl in Lavapiés als auch in La Latina befinden sich neben vielen kleinen Gaststätten, die von Immigranten aus Asien, Afrika und Lateinamerika geführt werden, auch die besten Gaststätten mit typischen und traditionellen Gerichten der spanischen Hauptstadt. Am originellsten aber ist immer noch der Capricho extreme ñ o am unteren Ende der Calle Carlos Arniche. Es ist kein Lokal, keine Bar, es gibt keinen Innenraum mit Sitzgelegenheiten, vielmehr handelt es sich um einen kleinen Raum im Parterre eines Wohnhauses , wo verschieden belegte tostas (auch eine vegane ist darunter) zu einem Preis von 3 Euro und einem Dosenbier durch zwei Fenster auf die Straße gereicht werden. Die Hausnummer 30 muss man sich nicht merken, denn es gibt kaum einen Sonn- und Feiertag, wo sich auf der Straße keine lange Schlange von Hungrigen bildet, die die auf Papptellern servierten tostas am Straßenrand stehend oder sitzend verzehren. So auch heute. Zur Feier der Wiedereröffnung gabs heute ein pollo apanado (paniertes Hühnerschnitzel) mit viel Mayonnaise.
Es herrschte zumindest um die Mittagszeit ein mildes Wetter: Strahlend blauer Himmel und viel Sonnenschein bei angenehmen 18 bis 20 Grad. Und doch war vieles anders als bei früheren Besuchen. Die Beschränkung der Besucherzahl auf weniger als 3000 und das völlige Ausbleiben der Touristen schuf ein gedämpftes, ruhigeres und weniger hektisches Treiben, als man es von früher her gewohnt ist. Und die festgelegten Ein- und Ausgänge, die Vorgabe, in welche Richtung man zu gehen habe, die starke Polizeipräsenz, die über einem schwirrenden Überwachungsdrohnen und das obligatorische Tragen der mascarillas ließ keine besondere Stimmung aufkommen.
Und so verließen wir nach zwei Stunden den Rastro, spazierten durch Lavapiés, wo Immigranten aus Fernost, Schwarzafrika und Lateinamerika ziemlich konfliktfrei mit alt eingesessenen Madrider Familien zusammenleben, hinauf zur Plaza Tirso de Molina. In der Calle Mesón de Paredes ist die Taberna Antonio Sánchez ein letzter Zwischenstopp vor der siesta. Seine Gründung geht auf das Jahr 1787 zurück und gilt damit als älteste Bar Madrids.

Viele Kirchen in Madrid sind außen und im Inneren ziemlich schmucklos. Das geht auf die 30er Jahre des 20. Jh. zurück, als in der Endphase der Republik, Kommunisten und Anarchisten Gotteshäuser plünderten und niederbrannten. Auch während des Bürgerkrieges (1936-1939) wurden kirchliche Gebäude immer wieder durch Kämpfe in der Stadt oder Angriffe aus der Luft schwer beschädigt. Obwohl während der anschließenden franquistischen Diktatur die eine oder andere Kirche wieder aufgebaut wird, fehlte meist das Geld für eine fachmännische Restaurierung oder eine Wiederherstellung der früheren Pracht. Es gehört daher zu den schönsten Augenblicken eines Spaziergangs durch die spanische Hauptstadt, mehr zufällig als beabsichtigt auf den einen oder anderen Sakralbau zu stoßen und dabei auf historische Erinnerungen aufmerksam zu werden, die viele Madrilenen selbst nicht (mehr) kennen. Eine solche „Zufallsbegegnung“ ereignete sich heute.
Auf dem Rückweg von einem Sonntagsfrühstück im bekannten Café Gijón an der Prachtstraße La Castellana stoßen wir inmitten klobiger moderner Gebäude auf eine Kirchenfassade, die sich an der Stelle befindet, wo die Gran Vía in die Calle Alcalá mündet. Die Kirche selbst und ihre Ausmaße sind im Vorbeigehen gar nicht zu erkennen, da sie an den Längsseiten und an der Rückwand in eine Häuserflucht eingebaut ist. An dieser Stelle stand einst der bescheidene Convento de San Hermenegildo der Carmelitas descalzos (der Unbeschuhten Karmeliter), der Ende des 16. Jh. auf Betreiben der rührigen Nonne und Ordensgründerin Santa Teresa de Jesús erbaut wird. 1870 wird das Kloster abgerissen, nur die Iglesia de San José aus dem 18. Jh. bleibt erhalten.
Das Innere überrascht durch seine Dimension. Die dreischiffige Barockkirche ist mit wunderschönen und reich bestückten Seitenkapellen ausgestattet. Die verblüffendste Entdeckung ist aber eine Marmorplatte mit einer Inschrift, die wegen der Dunkelheit erst auf einem Foto gut zu lesen ist. Darauf wird festgehalten, dass in dieser Kirche am 26. Mai 1802 die Trauung des zu dieser Zeit noch unbekannten Simón Bolívar, des „Befreiers“ (Libertador) Venezuelas, Kolumbiens und Ecuador von der spanischen Kolonialherrschaft mit der Spanierin María Teresa Rodrigo del Toro y Alayza stattgefunden hat. Die Gedenktafel ist ein Geschenk der venezolanischen Regierung und wurde 1980, zum Gedenken an seinen 150. Todestag hier in der Kirche San José angebracht. Die Ehe dauerte nur acht Monate, am 22. Januar 1803 starb María Teresa an Gelbfieber.
Als ein Kirchenbediensteter, der die Kirche um 14 Uhr schließen will, sieht, wie wir das Foto von der Tafel machten, zeigt er sich erstaunt. In einem kurzen Gespräch erzählt er noch von einer anderen ziemlich unbekannten Begebenheit. In dem Vorläuferkonvent fand am 29. Mai 1614 die Primiz (die erste Messe) des bedeutenden Dramenschreibers Lope de Vega statt, nachdem er sich in seinen letzten Jahren noch zum Priester hat weihen lassen. Und einige Monate später ist auch die Anwesenheit von Miguel Cervantes bezeugt, der an diesem Ort im Rahmen einer literarischen Runde die im gleichen Jahr erfolgte Seligsprechung (beatificación) von Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, besser bekannt als Teresa von Ávila feiert.
Am letzten Dienstag, dem 9. November, jährte sich zum vierten Mal der Todestag von La Veneno , der ersten und zugleich berühmtesten Trans-Person Spaniens. Als José Antonio 1964 in der Provinz Almería geboren, lernt sie das Friseurhandwerk und identifiziert sich früh schon als Frau. Mit knapp 30 Jahren verlässt sie ihren Geburtsort Adria, um den ständigen Aggressionen ihrer Familie und Nachbarn zu entgehen. In Madrid arbeitet sie zunächst im Parque del Oeste als Prostituierte, tritt in zwei Pornofilmen auf, wird bald vom Fernsehen (Cadena Telecinco) entdeckt und als Cristina La Veneno ein gefeierter Medienstar. Nach einem längeren Gefängnisaufenthalt wegen angeblichen Versicherungsbetrugs schafft sie ein Comeback und schreibt ihre Autobiographie Ni puta, ni santa. Las memorias de la Veneno, für die sie lange keinen Verleger findet. Am 9. November 2016 stirbt sie unter bis heute nicht geklärten Umständen in einem Madrider Krankenhaus. Ihre Asche wird zur Hälfte nach Adria überführt, die andere Hälfte im Parque del Oeste verstreut. Obwohl die Madrider Stadtverwaltung ihr einen Straßennamen im Queer- Viertel Chueca verweigert, erhält sie eine Gedenktafel in „ihrem“ Park und wurde in dieser Woche in ausführlichen Presseartikeln und Fernsehsendungen gefeiert.
Die Erinnerung an d i e Veneno fällt zusammen mit einer aktuellen politischen Debatte, die immer wieder die politische Agenda der „Linken“ beschäftigt und mittlerweile zu einem Spaltpilz in der spanischen Koalitionsregierung zwischen den Sozialisten und Unidas Podemos geworden ist. Das Ministerium für Gleichheit (Ministerio de Igualdad) unter der Führung von Irene Montero, der Ehefrau des Podemos- Gründers Pablo Iglesias, bereitet seit Monaten ein Gesetz vor, das den vorläufigen Titel Ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans (Gesetz für die volle und effektive Gleichstellung von Trans-Personen) trägt. Es soll das 2007 unter der sozialistischen Regierung von Präsident José Luis Rodríguez Zapatero verabschiedete Transgender-Gesetz ablösen, das damals ein Meilenstein der spanischen Gesetzgebung darstellte, mittlerweile aber als stark reformbedürftig gilt. Danach gilt bis heute, dass eine Namens- und Geschlechtsänderung in Ausweispapieren oder amtlichen Schreiben nur nach einem medizinischen oder psychologischen Gutachten und dem Nachweis erfolgen darf, dass eine mindestens zweijährige Hormonbehandlung vorausgegangen ist. Dieses Gesetz ist in den letzten Jahren immer stärker in die Kritik geraten, vor allem durch Transpersonen selbst, aber auch von feministischen Zirkeln und sexuell diversen Aktivisten und Aktivistinnen in Frage gestellt worden. Der umstrittene Kern des geplanten neuen Gesetzes sieht eine individuelle Selbstbestimmung (autodeterminación) des Geschlechtes vor, ohne medizinisches Gutachten und ohne operative oder hormonelle Eingriffe. Es genügt die bloße Willenserklärung, sich als biologischer Mann (oder Frau) mit dem jeweils anderen Geschlecht zu identifizieren.
Dagegen laufen nun traditionelle feministische Organisationen Sturm, die vor allem der sozialistischen Partei nahe stehen. Sie teilen durchaus die proklamierten Ziele, die das Gesetz anstrebt: Eine Beseitigung der Diskriminierungen. denen Trans-Personen immer noch in besonderem Maße ausgesetzt sind. Eine breite Studie aus dem Jahr 2019 hat festgestellt: 85 % sind arbeitslos oder arbeiten in prekären Beschäftigungsverhältnissen, 42 % erfahren Beleidigungen, Bedrohungen oder tätliche Angriffe und 25 % sind sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigungen ausgesetzt. Das sind erschreckend hohe Zahlen.
Ein anderes Ziel ist eine Depathologisierung. Es kann nicht sein, dass Trans-Personen ständig mit dem Gefühl konfrontiert werden, es handle sich in ihrem Fall um eine physische oder psychische Krankheit, die mit Mitteln der Medizin behandelt werden muss. Vor allem wird das bestehende Gesetz der wachsenden Zahl von Männern und Frauen nicht gerecht, die sich im entgegen gesetzten Geschlecht wohl fühlen und als solches in der Öffentlichkeit anerkannt werden wollen, aber keine körperliche Geschlechtsumwandlung anstreben. An eine Frau mit Penis und einen Mann mit Vagina wird man sich gewöhnen müssen.
Ein solcher Fall war La Veneno . Sie hat sich seit ihrer Jugend als Frau gefühlt und identifiziert und ist als solche in der Öffentlichkeit aufgetreten, hat sich aber nie operieren oder hormonell behandeln lassen. Sie war also biologisch zeit ihres Lebens durch und durch ein Mann. Deshalb treffen traditionell verwendete Begriffe auf sie nicht zu. Sie ist weder transsexuell (wie sie immer noch bezeichnet wird) noch ein Transvestit, weil sie sich ja nicht nur gelegentlich schminkt und in Frauenkleider schlüpft. Sie ist nicht nur in ihrem äußeren Auftreten, sondern ihrem ganzen Selbstverständnis nach eine Frau, obwohl sie alle ihre männlichen Geschlechtsmerkmale behalten hat. Für solche Trans-Personen ist das neue Gesetz gemacht.
Was Feministinnen aber zum großen Teil mit Recht kritisieren, ist die Tatsache, dass eine individuelle Geschlechtsbestimmung allzu sehr der Beliebigkeit des Einzelnen ausgesetzt ist, gleichzeitig aber gewaltige gesellschaftliche und juristische Auswirkungen hat. Die gewünschte Diskriminierung wird durch das neue Gesetz nicht beseitigt, sondern auf andere Felder ausgeweitet. Man darf nicht glauben, dass alle Frauen erfreut sind, wenn sie mit Trans-Frauen (also biologischen Männern, die sich als Frau identifizieren), die gleichen Toiletten und Duschen teilen müssen. Und wie werden sich all die heterosexuellen Männer verhalten, wenn sie bei einem sexuellen Stelldichein mit einer Trans-Frau, die sie für eine „richtige“ Frau halten, mit für sie unangenehmen biologischen Tatsachen konfrontiert werden. Die Realität ist immer komplexer als eine noch so gut gemeinte Ideologie.
Um Trans-Personen vor Diskriminierung jeglicher Art zu schützen, braucht es in erster Linie keine neuen Gesetze, sondern eine andere Gesellschaft, so der feministische Tenor. Es müssen traditionelle Einstellungen, hartnäckige Vorurteile und die weit verbreitete Unwissenheit abgebaut werden. Dazu bedarf es einer offenen und freien Erziehung in den Schulen, eines aufgeklärten Denkens ohne ideologische oder religiöse Scheuklappen und einer grenzenlosen Neugierde auf alles Ungewohnte und vermeintlich Abgründige.
Wer immer noch glaubt, dass diese Frage ein unwichtiges Außenseiterthema ist, kann in dieser Woche folgendes in der spanischen Tageszeitung La Vanguardia lesen. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro verkündet öffentlich: Tenemos que dejar de ser un país de maricas (Wir müssen aufhören ein Land von Schwulen zu sein). Und der ungarische Regierungschef Víctor Orban, ein Mitglied der EU und der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament (Vorsitzender ist der CSU-Politiker Manfred Weber!!!) darf eine Verfassungsänderung anstreben, ohne dass das deutsche Medien (im Gegensatz zu spanischen) überhaupt zur Kenntnis nehmen bzw. endlich mit aller Schärfe sanktionieren.
Huertas ist eine volkstümliche Bezeichnung für ein Stadtviertel im Distrikt Centro, das mit Abstand das am meisten von Touristen besuchte ist, weil es über eine außerordentlich hohe Dichte von Bars, Restaurants und Musikkneipen verfügt. Es erstreckt sich nördlich der Calle de Atocha, beginnt oben an der Plaza de Jacinto Benavente (benannt nach dem Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 1922) und führt hangabwärts bis zum Paseo del Prado. Seinen Namen hat es von den Obst- und Gemüsegärten, die sich hier außerhalb der Stadtmauern bis zum Parque del Retiro hinzogen. Bereits ab dem 15. Jh. siedelte sich eine Reihe von Wanderbühnen an, was einige der bedeutendsten Schriftsteller und Schauspieler des Siglo de Oro, des „Goldenen Jahrhunderts“ (der Künste) bewog, hierher zu ziehen: Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo und andere. Was aber auch viel „fahrendes Volk“ von außen anzog und demzufolge Prostituierte, die nach zeitgenössischen Quellen so viele waren, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Von der zentralen Calle de Huertas, die das Viertel der Länge nach von West nach Ost durchzieht, hieß es: Calle Huertas, más putas que puertas (Calle Huertas, mehr Nutten als Türen). Anständigere Leute bezeichneten Huertas als Barrio de las Letras, „Literatenviertel“, ein Name, unter dem es bis jetzt touristisch vermarktet wird. Heute hat sich der „Straßenstrich“ verlagert, dafür gibt es viele kleine Buchhandlungen, unter anderem die Librería Iberoamericana (und den Verlag) des kürzlich verstorbenen Frankfurter Verlegers Klaus Dieter Vervuert sowie eine Anzahl von gut bestückten Antiquariaten.
Das alles wäre allenfalls einen regnerischen Stöber-Nachmittagsspaziergang oder einen abendlichen gastronomischen Rundgang wert, wäre Huertas nicht der Ort, wo einer der bedeutendsten Skandale der spanischen Literaturgeschichte stattgefunden hat. Es handelt sich um den bekanntesten spanischen Schriftsteller, d e n „Klassiker“ schlechthin, vergleichbar mit Goethe oder Shakespeare. Miguel de Cervantes verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Madrid, in einer Stadt, die er nicht besonders schätzte. Er wechselte einige Male die Wohnung, die allerdings nie weit voneinander entfernt lagen. Zuletzt wohnte er in der Calle de León im Herzen von Huertas. Das Haus wurde 1833 vom damaligen Besitzer abgerissen, obwohl er wusste, dass Cervantes hier die letzten Jahre seines Lebens verbracht und den zweiten Teil des Don Quijote vollendet hat. Eine Gedenktafel ist das einzige, was an seinen mehrjährigen Aufenthalt erinnert. Hier starb er am 22. April 1616. Cervantes, der gegen Ende seines Lebens dem Trinitarier-Orden beigetreten ist, gehörte zur Pfarrei San Sebastián, dessen Kirche an der Calle Atocha er sicher öfters besucht haben dürfte. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jh. erbaut und beherbergte die Cofradía de comediantes de la Virgen de la Novena, eine Bruderschaft, die die Interessen von Autoren, Schauspielern und Dramaturgen vertrat. Im Bürgerkrieg wurde sie in der Nacht vom 19. auf den 20. November 1936 aus Versehen von einer Bombe der franquistischen Luftwaffe getroffen und erst in den 50er Jahren wieder restauriert. Die Vorstellung, dass dieser vom Leben schwer gebeutelte Mann, die herrliche und ergreifende Figur des heiligen Sebastian am Hochaltar in stiller Bewunderung betrachtet hat, wie dieser die Schmerzen, die ihm die (hier unsichtbaren) Pfeile zugefügt haben, in männlich-stoischer Haltung erträgt, hat auch heute noch viel Tröstliches. Die Kirche zählt sicherlich nicht zu den wichtigsten oder künstlerisch ansprechendsten Gotteshäusern der Stadt, aber ich besuche sie bei jedem meiner Madrid-Aufenthalte immer sehr gern.
Dass Cervantes nicht auf dem kleinen zur Kirche gehörenden Friedhof auf der Rückseite begraben wurde (wo der berühmte Dramenschreiber und Zeitgenosse Lope de Vega bestattet ist), sondern im Convento de las Trinitarias Descalzas, nur fünf Gehminuten von seiner armseligen Behausung entfernt, ist wohl dem Umstand geschuldet, dass der Trinitarier-Orden einst das Lösegeld bereit gestellt hat, um ihn aus algerischer Gefangenschaft zu befreien. Der Friedhof existiert nicht mehr. An seinem Platz steht heute eine Blumenhandlung, die gerade umgebaut wird.
Wie man mit seinem Wohnhaus umgesprungen ist, so mit seiner Grabstätte. Jahrhundertelang kümmerte sich niemand um den Toten. Aufgrund von einigen Um- und Neubauten im Kloster der „unbeschuhten Trinitarier-Nonnen“ geriet sein Grab in Vergessenheit und niemand schien das weiter zu bekümmern. Während sein Werk in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde und er als Dichter europäischen Ruhm erlangte, blieb seine Person und das, was von ihr übrigblieb, unbeachtet. Nicht einmal die Ordensschwestern scheinen bis heute ein Interesse daran zu haben, eine Gedenkstätte in ihrem Kloster einzurichten. Ein Freund erzählte mir, dass bei einer der seltenen Führungen, die die Nonnen in Eigenregie veranstalten, nicht einmal sein Name erwähnt wird.
Erst im Jahre 2014 wurde ein ernsthafter, von der Madrider Stadtregierung finanziell unterstützter Versuch unternommen, seine Gebeine im Kloster zu suchen. Ein Team von rund 30 Archäologen, Historikern und Gerichtsmedizinern untersuchte die Krypta und fand zunächst einen Sarg mit den Initialen M C , was aber letztendlich nichts bewies. Auch die in sonstigen Fällen gerne angewandte DNA-Analyse scheint wenig Erfolg zu versprechen, hatte Cervantes selbst doch keine Nachkommen. Die einzige Möglichkeit, so die beteiligten Wissenschaftler, Knochenreste eindeutig zu identifizieren, ist wohl nur aufgrund von physischen Merkmalen und bekannten Krankheiten möglich. Cervantes besaß eine Adlernase und, wie er selbst schrieb, am Ende seines Lebens nur noch sechs Zähne. Vor allem interessiert die Forscher seine linke Hand, die er durch einen Schuss fast verloren hätte, als er im spanischen Heer während der Seeschlacht von Lepanto 1571 gegen die Osmanen kämpfte. Aufschlussreich könnte auch eine Untersuchung seiner Arthrose, Wassersucht und einer Leberzirrhose sein, die zuletzt möglicherweise seinen ganzen Körper und Knochenbau in Mitleidenschaft gezogen haben. Auf eine endgültige Lösung werden wir noch länger warten müssen.
Auf dem Rückweg stolpert man auf der Calle de Huertas über eines der literarischen Zitate verschiedener spanischer Autoren, die dort alle hundert Meter in den Boden eingelassen sind. Eines gibt den Beginn des Don Quijote wieder :
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor ...
In einem Ort der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor nicht langer Zeit ein junger Edelmann mit einer Lanze im Gestell, einem alten Schild, einem dürren Klepper und einem flinken Jagdhund ... (Übersetzung von mir).
Vielleicht dachte Cervantes beim Verfassen dieser Zeilen gar nicht an eines der zehn gottverlassenen Käffer auf der kastilischen Hochebene, die bis heute darum streiten, in welchem Don Quijote gewohnt hat, bevor er vergeblich auszog, die Welt zu verbessern, sondern an Madrid, das ihn im Leben und im Tod so schmählich behandelt hat.
Während wir noch auf der Plaza de Santa Ana in der berühmten Cerveceria Alemana bei einem Gordon´s con tónica dem abenteuerlichen Leben dieses Dichter-Heroen, der so einsam sterben musste und bald vergessen war, nachsinnen, schweift unser Blick immer wieder auf die bescheidene Figur eines anderen berühmten Schriftsstellers, die mitten auf dem Platz direkt vor unseren Augen steht: Federico García Lorca. Sein Schicksal war noch härter. Er wurde im August 1936 (der genaue Tag steht bis heute nicht fest) in der Nähe von Granada „von der reaktionärsten Bourgeosie“ erschossen. Er teilt das gleiche Schicksal wie Cervantes. Sein Leichnam wurde damals auf irgendeinem Feld verscharrt und bis heute trotz aufwändiger Suchanstrengungen nicht gefunden. Auch er war auf der Suche nach einem besseren und freieren Spanien, in gewissem Sinne war er ein moderner „Don Quijote“. Seine wahre Person wurde nach seiner Hinrichtung von seinen Mördern totgeschwiegen und sein Werk Jahrzehnte lang (zum großen Teil bis heute) missdeutet.
Am liebsten hätten wir nochmals den heiligen Sebastian besucht, dessen Anblick jedem Betrachter tief in die Seele greift. Das Portal der Kirche war jedoch schon geschlossen.
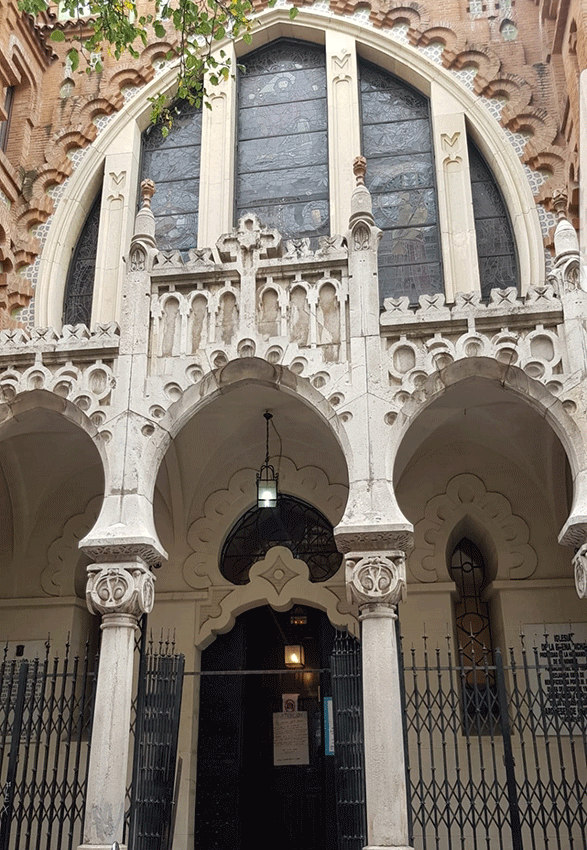
Malasa ñ a bildet keine administrative Einheit, ist also weder ein Stadtbezirk (distrito) noch ein Stadtteil (barrio) Madrids , obwohl er von den Touristen und auch von vielen Bewohnern Madrids als solcher betrachtet wird. Er gehört zum Distrikt Centro und zum Stadtteil Universidad. Es ist ein Stadtviertel, das sich zwischen der Calle Fuencarral (im Westen) und der Calle San Bernardo (m Osten), der Gran Vía (im Süden) und der Calle Carranza (im Norden) erstreckt. Es hieß lange Zeit Barrio de las Maravillas, nach der im Kloster der unbeschuhten Karmeliterinnen verehrten Mariendarstellung Nuestra Se ñ ora de las Maravillas. Das Kloster befand sich im Zentrum des Stadtviertels und existiert heute nicht mehr. Seinen jetzigen Namen erhielt das Viertel nach der Schneiderin Manuela Malasaña, die hier Ende des 18. Jh. lebte.
Als die napoleonischen Truppen Madrid erobert hatten, erhob sich die Madrider Bevölkerung am 2. Mai 1808 gegen die Invasoren. Manuela und ihr Vater, die aktiv am Aufstand teilgenommen hatten, kamen dabei ums Leben. Bis weit ins 20. Jh. hinein war Malasa ñ a eine wenig ansprechende Gegend, am Ende der Franco-Diktatur war es bevölkert von Dealern, Strichern und Prostituierten. Erst seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich Malasa ñ a zum Zentrum der so genannten Movida Madrile ñ a. Mit dem Beginn der Demokratie entstand eine gesellschaftliche und kulturelle Aufbruchsstimmung, die in wenigen Jahren Spanien und vor allem seine Hauptstadt verändern sollte. Malasa ñ a war das Zentrum dieser Kulturrevolution. Eine rebellische Jugend forderte individuelle, künstlerische und sexuelle Freiheiten ein, die es so in Spanien noch nie gegeben hatte. Überall wurde improvisiert und experimentiert: in der Musikszene, auf der Theaterbühne, im Film und in den neuen Medien. Zwei Ereignisse aus dieser Zeit sind mir noch in Erinnerung geblieben. Das große Konzert im Februar 1980 zu Ehren des bei einem Verkehrsunfall tödlich umgekommenenSängers José Enrique Canoleal (genannt Canito) in der Universidad Politécnica. Und die Uraufführung von Pedro Almodóvars erstem Kinofilm Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón wenige Monate später (den Namen des Kinos habe ich vergessen). Der Film war ein Fanal der beginnenden Frauenemanzipation, der mit einem Schlag die Gesellschaft von der Jahrzehnte lang vorherrschenden Macht der Kirche und einer ranzigen katholischen Sexualmoral befreite. Vor allem Alaska, eine mexikanische Sängerin und Schauspielerin (mit bürgerlichem Namen Maria Olvido Gara Jova) wurde in der Rolle Boms zum Vorbild eines neuen Frauenbildes.
Auf die Movida erfolgte der desencanto, die Ernüchterung. Malasa ñ a veränderte in wenigen Jahren sein Flair. Heute ist es eines der teuersten Wohngegenden der Stadt, „gentrifiziert“ wie die barrios Chueca und Lavapiés (nur mit weniger Schwulen, bzw. Immigranten) und heute sind die rauchigen Untergrundkeller zu schicken Jazzkneipen geworden und haben neue, oft sterile Bars und Restaurants eröffnet.
Das Viertel hat aber für den Historiker und Kunstliebhaber einiges zu bieten. Drei Highlights möchte ich für einen Besuch empfehlen: zwei Kirchen und einen für die spanische Geschichte bedeutsamen Platz.
Wenn man Malasa ñ a von der Gran Via aus über die Plaza de Luna betritt, erreicht man nach wenigen Minuten eine der schönsten Kirchen der Stadt: San Antonio de los Alemanes. König Philipp III. gründete hier 1603 das Hospital de San Antonio de los Portu gueses. Es diente den durchreisenden Portugiesen als Krankenhaus und Armenunterkunft und stand daher unter dem Schutz des in Lissabon geborenen heiligen Antonius. Der Bau der Kirche erfolgte erst zwei Jahrzehnte später. Als sich 1640 Spanien, das 60 Jahre lang mit Portugal in einer Personalunion vereinigt war, wieder von seinem Nachbarn trennte, änderte der Nachfolger, König Philipp IV. , der mit Mariana de Austria verheiratet war, den Namen und jetzt kamen (möglicherweise hat sie darauf bestanden?) anstelle der Portugiesen die „Deutschen“ in den Genuss einer anständigen Pflege. Die unscheinbare Fassade verrät nichts von der prachtvollen Innenausstattung. Rund 1500 Quadratmeter Wandflache sind mit bunten und gut erhaltenen Fresken bemalt. Auf dem Hochaltar steht eine wundervolle Barockfigur des Heiligen mit dem Jesuskind.
An der Kirche beginnt die lange Calle del Pez , von dieser aus biegen wir in die Calle de las Minas und danach in die Calle del Espiritu Santo ab. Über die Calle San Andrés erreichen wir die Plaza de Dos de Mayo . Auf diesem rund fünfzehnminütigen Spaziergang erhält man einen guten Einblick in die engen Straßen und schön restaurierten Gebäude. In der Mitte des Platzes steht unter einem Torbogen und von einem Gitterzaun umgeben das Denkmal für die zwei Militärs, die führend am Aufstand gegen die Franzosen beteiligt waren und dabei ums Leben gekommen sind. Auf dem Sockel stehen ihre Namen: (Luis) Daoiz (y Torres) und (Pedro) Velarde (y Santillán).
Vom Platz aus in südlicher Richtung kommen wir wieder auf die Plaza de Luna. An der schmalen abwärts führenden Calle de Silva steht auf der rechten Seite die Iglesia de la Buena Dicha, die Kirche des Guten Glücks. Sie wurde 1594 zusammen mit einem Hospital und Friedhof für die Armen Madrids errichtet. Im Krankenhaus wurden viele Verwundete des Mai-Aufstandes behandelt und gepflegt, auf dem Friedhof auf der Rückseite wurde Manuela Malasaña begraben. Heute sind Hospital und Friedhof verschwunden. Die Kirche wurde während des 1. Weltkrieges auf Initiative der Marqueses de Hinojares von dem Architekten Francisco García Nava in dem damals üblichen eklektischen Stil völlig neu gestaltet.
Inmitten der momentan herrschenden Ausnahmesituation, zwischen Estado de Alarma (Alarmzustand, bis Mai 2021 verlängert), Toque de queda (Ausgangssperre, in Madrid zwischen 24 und 6 Uhr früh) und Confinamiento (Mobilitätsbeschränkung, die je nach Autonomer Gemeinschaft flexibel geregelt ist) muss der Tagesablauf genauer als sonst geplant werden. Wer den permanent dröhnenden Sirenen der Polizeifahrzeuge und Krankenwagen entgehen will, die pausenlos in den Medien verbreiteten Angriffe der Regionalpräsidentin Díaz Ayuso gegen die von der Regierung Sánchez verhängten Antipandemie-Maßnahmen nicht mehr hören kann, den nächtlichen Straßenschlachten und Barrikadenkämpfe einer aufgebrachten Jugend gegen die Polizei aus dem Weg gehen will, hat immerhin die Möglichkeit, eines der wieder geöffneten Museen zu besuchen. Natürlich gelten auch hier die üblichen Regeln (Kartenkauf im Internet, vorgeschriebene Einlasszeit, keine Mitnahme von Taschen und Rucksäcken), dafür wird man aber hundertfach entschädigt, durch keine endlosen Warteschlangen am Eingang, durch wenige Besucher im Inneren und durch prachtvolle Ausstellungen, die zur Zeit geboten werden.
Besonders der Prado lädt zu einem einzigartigen Erlebnis ein. Man kann sich gar nicht mehr die Wohltat vorstellen, diesen spanischen Kunsttempel nicht mit Hunderten von Touristen gleichzeitig durchlaufen zu müssen, sondern nur mit wenigen Einheimischen zu teilen (nur 16 % der Einwohner Madrids haben 2019 das Museum besucht). Besonders zwei aktuelle Sonderausstellungen darf man nicht versäumen.
Von Anfang Juni bis Ende November hat die Museumsleitung unter dem Titel Reencuentro (Wiederbegegnung) eine Neuaufhängung von 250 Gemälden aus dem permanenten Museumsbestand zusammengestellt, die mit sattsam Bekanntem überrascht. Diego Velázquez´ Bilder, sonst über mehrere Säle verteilt, wurden so nebeneinander gehängt, dass neue Einblicke in sein Schaffen möglich werden. Die weltberühmten Las Meninas (Die adeligen Fräulein) zusammen mit den Hilanderas (Die Spinnerinnen) , den borrachos (Betrunkenen) und mehreren bufones (Hofnarren) z eigen des Meisters Kritik an der Welt des Adels und des königlichen Hofes neben seiner Sympathie für das niedere Volk.
Eine im Oktober eröffnete Ausstellung setzt sich zum ersten Mal mit einem heiklen Thema auseinander. Invitadas (Eingeladene Frauen) zeigt einerseits das von den Museumskuratoren des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts wenig (oder gar nicht) beachtete Schaffen von Künstlerinnen, aber auch das misogyne Frauenbild, das in dieser Epoche vorherrschend war. Die 130 Bilder stammen überwiegend aus den Depots des Museums und waren noch nie öffentlich gezeigt worden. Das gilt auch für die Mehrheit der wenigen Leihgaben, die die Ausstellung komplementieren. Sie ist noch bis März 2021 zu sehen.
Anlässlich seines hundertjährigen Bestehens im kommenden Frühjahr hat das Museum Thyssen-Bornemisza eine außerordentliche Schau deutscher expressionistischer Maler zusammen getragen. Zu den 44 hauseigenen Gemälden hat die Familie noch weitere aus ihren Privatsammlungen beigesteuert. Es sind fast alle berühmten deutschen Maler des Expressionismus vertreten. Besonders interessant (auch wegen ihrer Provenienzgeschichte) sind fünf Bilder, die von den Nazis aus deutschen Museen konfisziert und dann international zum Verkauf angeboten worden und so in den Besitz des Barons und seiner Familie gekommen sind: „Metrópolis“ von George Grosz, „Nubes de verano“ von Emil Nolde, „Dos desnudos femeninos en un paisaje“ von Otto Müller, „Feria de caballos“ von Max Pechstein und „Retrato de Siddi Heckel“ von Erich Heckel. Die Ausstellung läuft noch bis zum Frühjahr nächsten Jahres.

Ein grauer und kühler Tag, nur wenige Menschen auf der Straße. Im Moment tagt das Parlament und diskutiert eine weitere Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen. Wir besuchen die Kathedrale de la Almudena. Wo sich sonst Touristengruppen gegenseitig auf die Füße treten, ist heute kein Mensch weit und breit zu sehen. Ein wunderbares Gefühl, allein in diesem prächtigen Bau umherlaufen zu dürfen und sich dabei die merkwürdige Geschichte dieses Baus vor Augen führen zu können.
Die Geschichte dieses Gotteshauses dürfte einzigartig in der europäischen Sakralarchitektur sein. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts, als König Philipp II. Madrid zur Hauptstadt des Königreiches Spanien bestimmt hatte, gab es Versuche, in der Stadt eine große und prächtige Kirche zu errichten, die eine würdige Bleibe für die Virgen de la Almudena, die Patronin der Stadt, bieten sollte. Kein geringerer als der Apostel Jakobus soll die Marienfigur in die Stadt gebracht haben. Als zu Beginn des 8. Jh. die Invasion der islamisierten Araber und Berber drohte, versteckten sie die Stadtbewohner zusammen mit zwei brennenden Kerzen. Als König Alfons VI. Ende des 11. Jh. die Stadt für die Christen zurück eroberte, fand man natürlich auch sofort wieder die Virgen de la Almudena, sogar die zwei Kerzen neben ihr brannten noch. In der bescheidenen Kirche Santa Maria (gegenüber der heutigen Kathedrale) erfuhr die Almudena bis zu deren Abbruch in der Mitte des 19. Jh. eine wachsende Verehrung.
Die Gründe, warum die Virgen Jahrhunderte lang derart unstandesgemäß untergebracht war, lag zum einen am Erzbischof von Toledo, der als „Primas“ der spanischen Bischöfe um die Privilegien und Vorrechte seines Bischofsitzes fürchtete, scheiterte zum anderen aber auch immer wieder am Madrider Stadtrat, der sich weigerte, das nötige Geld für den Bau einer großen Kathedrale zu bewilligen.
Wieder verfloss viel Zeit, bis endlich eine beherzte Frau die Sache in die Hand nahm. Doña María de las Mercedes de Orléans, die Gattin König Alfons XII., brachte neuen Schwung in die Angelegenheit. Als glühende Verehrerin der mittlerweile zur Patronin Madrids erhobenen Jungfrau spendierte sie einen Teil ihres persönlichen Schmuckes sowie einige Grundstücke, die direkt an den königlichen Palast grenzten, um der Virgen ganz nahe sein zu können. Diese beschloss jedoch, dass die junge Königin ihr noch näher sein sollte. Und so starb die erst Achtzehnjährige am 27. Juni 1878. Ihr früher Tod veranlasste den König, den Bau der Kathedrale, den seine Frau so sehnsüchtig gewünscht hatte, zielstrebig und energisch in die Hand zu nehmen. Und doch sollte ihre endgültige Fertigstellung noch weitere hundert Jahre auf sich warten lassen.
Am 4. April 1883 legte Alfons XII. den Grundstein. Sein Architekt Francisco de Cubas entwarf ein Gotteshaus im neogotischen und eine Krypta im neoromanischen Stil, die zu dieser Zeit in Mode waren. Die Unterkirche, die einen eigenen Zugang von der Cuesta de la Vega aus besitzt, wurde 1911 fertig gestellt. Im rechten Seitenschiff befindet sich das Grab von Carmen Franco Polo, der einzigen Tochter des Diktators. Sie hat diese Grablege 1987 für sich und künftige Familienmitglieder erworben. Bisher liegen hier ihr 1998 verstorbener Mann Cristóbal Martínez-Bordiu und seit 2017 sie selbst. Als im vergangenen Jahr die Exhumierung Francos aus dem Valle de los Caidos bevorstand, forderte die Familie, dass seine sterblichen Überreste hier bestattet werden. Nur eine konzertierte Aktion zwischen der spanischen Regierung und dem Vatikan konnte dieses Ansinnen im letzten Augenblick verhindern. Heute liegt der caudillo auf dem Cementerio Mingorrubio im Madrider Distrikt El Pardo.
Die enge Verbindung mit dem spanischen Königshaus bezeugen zwei weitere Ereignisse: Im Jahre 2000 konnte der sehnlichste Wunsch von María de las Mercedes erfüllt werden. Ihr Leichnam wurde aus dem Escorial, wo sie seit ihrem Tod eine provisorische Ruhestätte gefunden hatte, nach Madrid überführt und fand ihre letzte Ruhe direkt zu Füssen der Virgen de la Almudena. Näher gings nicht mehr. Und am 22. Mai 2004 heirateten Felipe, der damalige Prinz von Asturien, die bürgerliche und geschiedene Journalistin Leticia Ortíz.
Der moderne Stil der Innenausstattung gefällt nicht allen Besuchern, insbesondere die modernen Wandgemälde und bemalten Glasfenster sind umstritten. Auf mich wirkten sie immer sehr harmonisch und beruhigend, besonders heute, wo ich alle einzeln und in großer Ruhe betrachten konnte. Beim Verlassen der Kirche ist es noch düsterer geworden. Und das nicht nur in klimatischer, sondern auch politischer Hinsicht. Die Nachrichten verkünden soeben, dass die Cámara de Diputados mit großer Mehrheit (ohne die Stimmen der Volkspartei und von Vox) eine Verlängerung des Estado de Alarma bis Mai 2021 beschlossen hat.
In den letzten Wochen des vergangenen Jahres überschlugen sich die politischen Ereignisse in Bolivien, einem Land, das in den letzten Jahren nur selten die Aufmerksamkeit der europäischen Medien erregte. Der langjährige Präsident des kleinen Andenstaates, Evo Morales, stellte sich im Oktober 2019 zum vierten Mal in Folge einer Wiederwahl. Um einer Stichwahl mit dem zweitplatzierten Kandidaten zu entgehen, kam es wohl zu Unregelmäßigkeiten (bewiesen ist das bis heute nicht), die die bürgerliche Opposition und das mit ihr verbündete Militär als „Wahlbetrug“ bezeichnete. Es kam zu lokalen Aufständen gegen den Präsidenten und die Mitglieder seiner Partei, der „Bewegung zum Sozialismus“ (Movimiento al Socialismo / MAS). Evo Morales trat daraufhin am 10. Dezember zurück und begab sich am nächsten Tag ins mexikanische, einen Monat später ins argentinische Exil, wo er sich bis heute aufhält.
Seine Person und seine Politik sind seit seiner ersten Wahl zum bolivianischen Präsidenten 2006 im Lande höchst umstritten. Er gehört dem Stamm der Aymara an und war somit das erste indigene Staatsoberhaupt Lateinamerikas. Die Politik der ersten zehn Jahre war konsequent sozialistisch ausgerichtet, was ihn nicht nur bei der überwiegend sozial schwachen und indigenen Bevölkerung beliebt machte, sondern auch bei den europäischen Linken hohe Popularitätswerte bescherte. Er gilt als „Vater des bolivianischen Wirtschaftswunders“, der das Bruttoinlandsprodukt um jährliche 5 % steigerte, die extreme Armut mehr als halbierte, das weit verbreitete Analphabetentum erfolgreich reduzierte, einen kostenlosen Zugang zum Schul- und Gesundheitswesen ermöglichte und die Rechte der benachteiligten indigenen Volksgruppen im Land stärkte und in der Verfassung verankerte. Ein Gesetz zur Anerkennung und Stärkung verschiedener geschlechtlicher Identitäten ( Ley de Identidad de Género) ist seit 2016 in Kraft und hat das Leben vieler schwuler Männer, lesbischer Frauen, transsexueller und transgender Personen erleichtert; die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe wird sein Jahren in einer Parlamentskommission in Gesetzesvorlagen vorangetrieben, von Seiten katholischer Bischöfe bislang aber erfolgreich torpediert.
Diese positive Bilanz seiner 13-jährigen Regierungszeit hat Morales in den letzten Jahren nicht ohne eigenes Zutun gefährdet. Sein zunehmend selbstherrlicher Kult um seine Person, sein zunehmend autoritäres Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit, seine Zusammenarbeit mit der einheimischen Drogenmafia, vor allem den cocaleros im Departamento von Cochabamba und die alltägliche Korruption bis in die Spitzen seiner Regierung, haben sein Image gewaltig verdüstert. Da war die Enthüllung eines sexuellen Verhältnisses mit einer Minderjährigen im letzten Wahlkampf nur noch ein weiterer Tropfen auf den berühmten heißen Stein.
Nach seinem Rücktritt vom Präsidentenamt übernahm Jeanine Añez, die Vizepräsidentin des Parlaments interimistisch die Regierungsgeschäfte zur Vorbereitung von Neuwahlen. Diese wurden coronabedingt zweimal verschoben, was die Konfrontation zwischen dem linken und dem bürgerlichen Lager weiter befeuerte. Sie fanden schließlich am 12. Oktober 2020 statt. Das Ergebnis war einigermaßen überraschend. Es traten fünf Kandidaten zur Wahl an, nachdem die Übergangspräsidentin ihre Kandidatur kurzfristig aufgab, um, wie sie selbst als Begründung angab, das rechte Lager zu stärken und einen Sieg des Kandidaten des MAS im 1. Wahlgang zu verhindern. Trotzdem blieb die Opposition zersplittert. Für den Movimiento al Socialismo trat Luis Arce, der langjährige Wirtschaftsminister unter Evo Morales, an. Für die gemäßigt-konservative Comunidad Ciudadana (Bürgerblock) stand Carlos Mesa an der Spitze. Der rechts-nationalistische Luis Fernando Camacho vom Parteienbündnis Creemos (Wir glauben) hatte als dritter Bewerber nur geringe Erfolgsaussichten. Unter „ferner liefen“ traten Chi Hyun Chung und Feliciano Mamami an, deren Wahlergebnis jeweils unter 2 % blieb. Der Wahlsieger stand schon am folgenden Tag fest, obwohl das offizielle Wahlergebnis erst eine Woche später bekannt gegeben wurde. Arce erreichte bereits im 1. Wahlgang mit 55,1 % die absolute Mehrheit. Mit großem Abstand folgt Mesa mit 28,8 % und Camacho mit 14,0 %.
Was folgt daraus für die Zukunft Boliviens?
Eine zentrale Frage wird sein, wie der neue Präsident mit seinem Vorgänger umgeht? Evo Morales hat schon angekündigt, dass er am 11. November (wie symbolträchtig – am 11. November 2019 hat er Bolivien Richtung Mexiko verlassen!) zurückkehren will. Wird er nach seiner Ankunft von der Justiz für seine Delikte angeklagt und verurteilt werden oder hält Arce seine schützende Hand über ihn? In einem Interview in der FAZ vom 23. Oktober 2020 hat er unmissverständlich, dass er und nicht Evo regieren wird. Diese Frage wird in den nächsten Wochen und Monaten spannend bleiben.
Ebenso bedeutsam dürfte sein, ob Arce den politischen Kurs von Morales fortsetzen wird oder neue Akzente setzt. Auch hier klingen die Ankündigungen versöhnlich. Wir werden auch mit denen zusammenarbeiten, die uns nicht gewählt haben, so Arce. Ökonomisch will er den Prinzipien seiner Politik der letzten Jahre folgen. Im einzelnen nennt er die Förderung von Bodenschätzen, der Energieversorgung, der Nahrungsmittelindustrie und des Binnentourismus. Interessant sind auch seine Aussagen zum Umweltschutz und Klimawandel, auf das in Zukunft ein größeres Gewicht gelegt werden soll als in der Vergangenheit, und zur künftigen ideologischen Ausrichtung. Hier werden Europa und die Vereinigten Staaten, mit denen man friedliche Beziehungen unterhalten möchte, nicht mehr als „Imperialisten“ beschimpft, wohl aber die multinationalen Konzerne. Es wird spannend werden, wie Arce diesen Spagat hinbekommen wird.

Ein kühler frischer Wind strich heute Morgen durch die Straßen Madrids, dunkle graue Wolken am Himmel und trotz weiter geltendem Estado de Alarma waren um 11 Uhr ziemlich viele Menschen unterwegs. Von der Plaza de Lavapiés spazierten wir abwärts Richtung Río Manzanares, durchquerten das riesige Gelände des alten Schlachthofs (heute das Kulturzentrum El Matadero) und erreichten südlich des Flusses den Distrikt Usera. Er ist einer der 21 Stadtbezirke Madrids.
Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts heiratete die Tochter eines in der Gegend ansässigen reichen Landbesitzers den Coronel Marcelo Usera, der schnell erkannte, dass die Parzellierung und der Verkauf der Grundstücke mehr einbrachte als eine landwirtschaftliche Nutzung. Ab den 60er Jahren siedelten sich in Usera immer mehr Zuwanderer aus den ärmlichen Regionen Spaniens an und die Bevölkerung wuchs sprunghaft an. Drogenhandel und Straßenkriminalität hielten Einzug und es ist der Zuwanderung von Immigranten ab der Jahrtausendwende zu verdanken, dass der Stadtbezirk sein Aussehen komplett verändert hat. Heute ist Usera der Madrider Stadtteil mit der größten Ausländerdichte (rund 25-30 Prozent der Gesamtbevölkerung), weit mehr als im Multikultiviertel Lavapiés. Die größte Gruppe bilden die rund 11000 Chinesen, gefolgt von einigen Tausend Bolivianern. Dutzende von Geschäften, Bars und Restaurants dieser beiden Gruppen säumen die Straßen und machen den besonderen Charakter Useras aus.
Gleich nach der Brücke über den Mazanares wollten wir einer der sonderlichsten Bars der spanischen Hauptstadt einen Besuch abstatten, die ich von früheren Aufenthalten her kannte: die Bar Oliva. Sie gehört Chen Xiangwei, der als überzeugter Franco-Anhänger die Fassade des Lokals mit den spanischen Nationalfarben bemalt und im Inneren die Wände mit unzähligen Andenken, Bildern, Zeitungsausschnitten, usw. übersät hat. Er selbst ist ein sympathischer Mann in den 40ern, der sich gerne mit seinen Gästen über die Geschichte des Diktators unterhält und nichts dabei findet, sich mit erhobener Hand ablichten zu lassen. Die rechtsradikale Francisco-Franco-Stiftung hat ihn vor einigen Jahren mit dem Titel Caballero de Honor ausgezeichnet. Dieses Unikum ist jetzt zu unserer Überraschung ein weiteres Opfer der Pandemie geworden, seit einigen Monaten geschlossen und wird wohl, wenn überhaupt, nicht mehr so schnell öffnen.
Als nächstes steuerten wir
das Restaurant La Perla
in der Calle Monedero
an. Eigentlich war es
geschlossen, doch dank Julios Bekanntschaft mit dem Besitzer schloss er uns auf
und erlaubte auch Fotos zu machen.
Wieder eine einzigartige Skurrilität: Im Eingangsbereich befindet sich ein
reich geschmücktes Marienbild, die Virgen
de Urkupi
ñ
a,
die patrona de
Cochabamba.
Ihre Verehrung geht auf eine Marienerscheinung zu Beginn des
18. Jahrhunderts zurück, als einem Hirtenmädchen öfters die Jungfrau Maria
erschienen ist und daraus mit der Zeit ein Kult erwuchs, der heute in vielen
Ländern Lateinamerikas verbreitet ist. Am 15. August wird in Usera
ihr Fest gefeiert, mit bunten
Straßenumzügen und traditionellen Tänzen.
Die Mittagessenszeit nahte
und wir einigten uns auf ein Restaurant mit traditionell bolivianischen
Gerichten. Im Los Cantaritos
in der Calle Amor Hermoso,
der „Straße der
Schönen Liebe“ kehrten wir ein und bestellten das einzige Menü, das es heute
gab: Zur Vorspeise: eine Salte
ñ
a boliviana,
einer sehr saftigen, mit Fleisch, Kartoffeln,
gekochtem Ei und Ají gefüllten empanada.
Danach
eine Sopa de Chairo
mit Rindfleisch,
Mais und Weizen (sehr sättigend) und als Hauptgericht einen Pique a lo macho,
Fleisch, Würstchen, Kartoffeln
, Tomaten, Zwiebeln und hart gekochten Eiern, alles reichlich mit Senf und
Mayonnaise zugedeckt. Wem das alles noch
nicht scharf und deftig genug ist, kann sich noch aus einem bereit gestellten Töpfchen
mit Llajua (
bestehend aus jeder Menge Lojoto,
der schärfsten Chilischote
des Andenraums) bedienen. Dazu jede Menge Pace
ñ
a,
ein original importiertes Bier aus Bolivien. Nachdem es mittlerweile zu
regnen begonnen hat, half nur noch ein Taxi, das uns ins Zentrum zurückfuhr.
Die eineinhalb Tage dauernde Parlamentsdebatte ist heute am frühen Nachmittag zu Ende gegangen. Der Anlass war ein Misstrauensantrag (moción de censura) der rechtsradikalen Vox -Partei gegen die Koalitionsregierung Pedro Sánchez und Pablo Iglesias. Vox verfügt über 52 Sitze im 350 Abgeordnete umfassenden spanischen Parlament (Cámara de Diputados). Obwohl kein leiser Hoffnungsschimmer bestand (auch dann nicht, wenn die 89 Abgeordneten des konservativen Partido Popular, die bis heute Morgen offen ließen, ob sie den Antrag ablehnen oder ihm zustimmen werden), wollte sich Vox- Vorsitzender Santiago Abascal heute zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen, was nur mit einer absoluten Mehrheit möglich gewesen wäre. Was war dann der Sinn dieser Veranstaltung in einer Zeit, in der Spanien wegen der Corona-Pandemie in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise steckt? Abascal wollte dem „rechten“ Lager, das seit über einem Jahr einen Block bildet, auf den sich drei Regierungen in den Autonomen Gemeinschaften Andalusien, Murcia und Madrid stützen, eine große öffentliche Bühne bieten und sich selbst dabei als die starke Führungsfigur profilieren. Es wäre ein deutliches Signal nach außen gewesen, wenn der PP und die rechtsliberale Ciudadanos- Partei den Misstrauensantrag geschlossen unterstützt, oder sich zumindest der Stimme enthalten hätten. Die ausgedehnte Redezeit, die ihm als Se ñ or Candidato verfassungsgemäß zusteht, nutzte Abascal nun aber nicht um ein konkretes Gegenprogramm zu dem der Regierung vorzustellen, sondern diente ausschließlich dazu, sein wirres und realitätsfernes Konglomerat von rechtsradikalen und faschistischen Ideen in größtmöglicher Öffentlichkeit zu propagieren. Er scheute dabei auch nicht vor persönlichen Beschimpfungen und Beleidigungen zurück, indem er Sánchez und Iglesias als „Kriminelle“, die Abgeordneten der baskischen, katalanischen und galicischen Regionalparteien als „Separatisten“, „Terroristen“ und „Mörder“ bezeichnete und ein generelles Verbot dieser Parteien forderte. Er strebt den sofortigen Austritt aus der Europäischen Union, feiert Trump, Salvini und Le Pen als seine Mitstreiter, befürwortet eine Schließung der Grenzen gegenüber allen Immigranten und will eine „national-atlantische Autarkie“ begründen, mit Spanien an der Spitze einer neuen geopolitischen Hemisphäre. Das ganze emphatisch überhöht durch ein kräftiges Viva el Rey! nach jedem zweiten Satz.
Die Abgeordneten (natürlich mit Ausnahme derjenigen von Vox) verhielten sich für spanische Verhältnisse ziemlich still und ließen den ganzen Unsinn stoisch über sich ergehen. Die Antworten der einzelnen Parteisprecher zeigten dann jedoch eine deutliche bis scharfe Ablehnung. Ruhig und besonnen, aber klar in der Sache erwiderte der Regierungschef Sánchez, überraschenderweise auch Vizepräsident Iglesias. Der Podemos- Vorsitzende hielt ein flammendes Plädoyer für einen dezentralen, plurinationalen und plurilingualen Staat, für eine konsequente Aufnahme von Flüchtlingen und Immigranten, die mittelfristig zur wirtschaftlichen Stärkung Spaniens beitrügen, für einen starken Schutz von Minderheiten und für sexuelle Diversität. Irgendwie hatte man beim Zuhören von Abascals faschistischen Phantasien und Iglesias´ demokratischen Igualitarismus–Konzept das Gefühl, in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts versetzt zu sein.
Mit Spannung wurde die Rede von Pablo Casado (Partido Popular) erwartet. Der streng rechts orientierte Parteiführer der Konservativen, der seit seiner Wahl vor zwei Jahren kein Problem damit hat, sich von Vox- Abgeordneten in Regional- und Munizipalparlamenten unterstützen zu lassen, um eine Regierungsmehrheit für seine Partei zusammenzubringen und der ein ausgesprochen unkompliziertes und freundschaftliches Verhältnis mit Abascal pflegt, hat sein Abstimmungsverhalten und das seiner Fraktionsmitglieder bis heute morgen geheim gehalten. Es war bekannt, dass die dem „harten Kern“ angehörenden Abgeordneten, wie z. B. Cayetana Álvarez de Toledo, die unlängst von Casado gefeuerte Parlamentssprecherin der Partei, sowie nach Umfragen rund 40 % der Parteibasis ein „si“ befürworten, war die Überraschung groß, als Casado in seiner halbstündigen Rede nicht nur ein klares „no“ zum Misstrauensantrag von Vox verkündet sondern auch seinen politischen „Freund“ Abascal persönlich mit scharfen Worten angreift. Er hob vor allem die proeuropäische Ausrichtung seiner Partei hervor sowie ihre Positionierung in der Mitte des politischen Spektrums, die mit Abascals Visionen nicht das geringste gemein haben.
Das Ergebnis der Abstimmung hätte nicht klarer ausfallen können. Nur die 52 Abgeordneten von Vox stimmten für ihren Antrag, alle anderen 298 Abgeordneten votierten geschlossen dagegen. Ein sichtlich geknickter Abascal verließ das Parlament und kommentierte das Geschehen als „erbarmungslos“ und „ungerecht“ und kündigte an, dass die Zusammenarbeit mit dem PP „schwieriger“ werden wird.